Ein Public-history-Projekt mit Studierenden
Ein Kooperationsprojekt mit dem Fachbereich Geschichte der TU Darmstadt fragte 2017 bis 2019 nach Erinnerungsorten der Freiheit, speziell der Meinungsfreiheit, in der Region. Studierende erforschten nicht nur historische Hintergründe, sondern hinterfragen auch, wie sich die Orte heute im Stadtraum und in der Wahrnehmung der Einwohnerschaft darstellen. In Form von Berichten, Dokumenten und Abbildungen haben sie ausgewählte Orte für die Wissenskarte der KulturRegion aufbereitet.
Orte der Meinungsfreiheit
 © Wikimedia Commons
© Wikimedia Commons
Erinnerungsort Liberale Synagoge, Darmstadt
 Björn Guderjahn
Björn Guderjahn
Eugen-Kogon-Straße, Darmstadt
 © Wikimedia Commons/Stefan Bellini
© Wikimedia Commons/Stefan Bellini
Gedenkort Güterbahnhof, Darmstadt
 © Christopher-Lee Gremm
© Christopher-Lee Gremm
Gedenktafel August Metz, Darmstadt

Gedenktafel Bücherverbrennung, Darmstadt

Gedenktafel Georg Büchner, ehemaliges Wohnhaus Grafenstraße, Darmstadt
 © Wikimedia Commons/Andreas Praefcke
© Wikimedia Commons/Andreas Praefcke
Ludwigsmonument, Langer Ludewig, Darmstadt
 Daria Vetrova
Daria Vetrova
Mauerrest Gefängnis Rundeturmstraße, Darmstadt
 © Wikimedia Commons/Daderot
© Wikimedia Commons/Daderot
Prinz Emil-Veteranen-Denkmal Herrngarten, Darmstadt
 Dawar Annas Amini
Dawar Annas Amini
Ehemaliges Hauptquartier des SDS, Frankfurt am Main
 Lara Riedel
Lara Riedel
Gedenkstätte Neuer Börneplatz, Frankfurt am Main
 © Wikimedia Commons/Thomas Pusch
© Wikimedia Commons/Thomas Pusch
Schöffer-Denkmal, Gernsheim
 © Wikimedia Commons
© Wikimedia Commons
Neustädter Markt, Hanau
 Foto Björn Guderjahn
Foto Björn Guderjahn
Staatspark Hanau Wilhelmsbad / Wilhelmsbader Fest, Hanau
 © Wikimedia Commons/Johannes Robalotoff
© Wikimedia Commons/Johannes Robalotoff
Burgruine / Gefängnis in der Festung, Königstein im Taunus

Eugen-Kogon-Weg und Eugen-Kogon-Preis, Königstein im Taunus
 © Wikimedia Commons/Tilmann2007
© Wikimedia Commons/Tilmann2007
Museum Stadt Miltenberg / Ehemaliger Amtssitz von Friedrich Weygandt, Wortführer der Reformation in Miltenberg
 © Felipe Beuttenmüller
© Felipe Beuttenmüller
Alter Ort, Neu-Isenburg
 © Stadtarchiv Neu-Isenburg
© Stadtarchiv Neu-Isenburg
Gedenktafel Bücherverbrennung, Neu-Isenburg
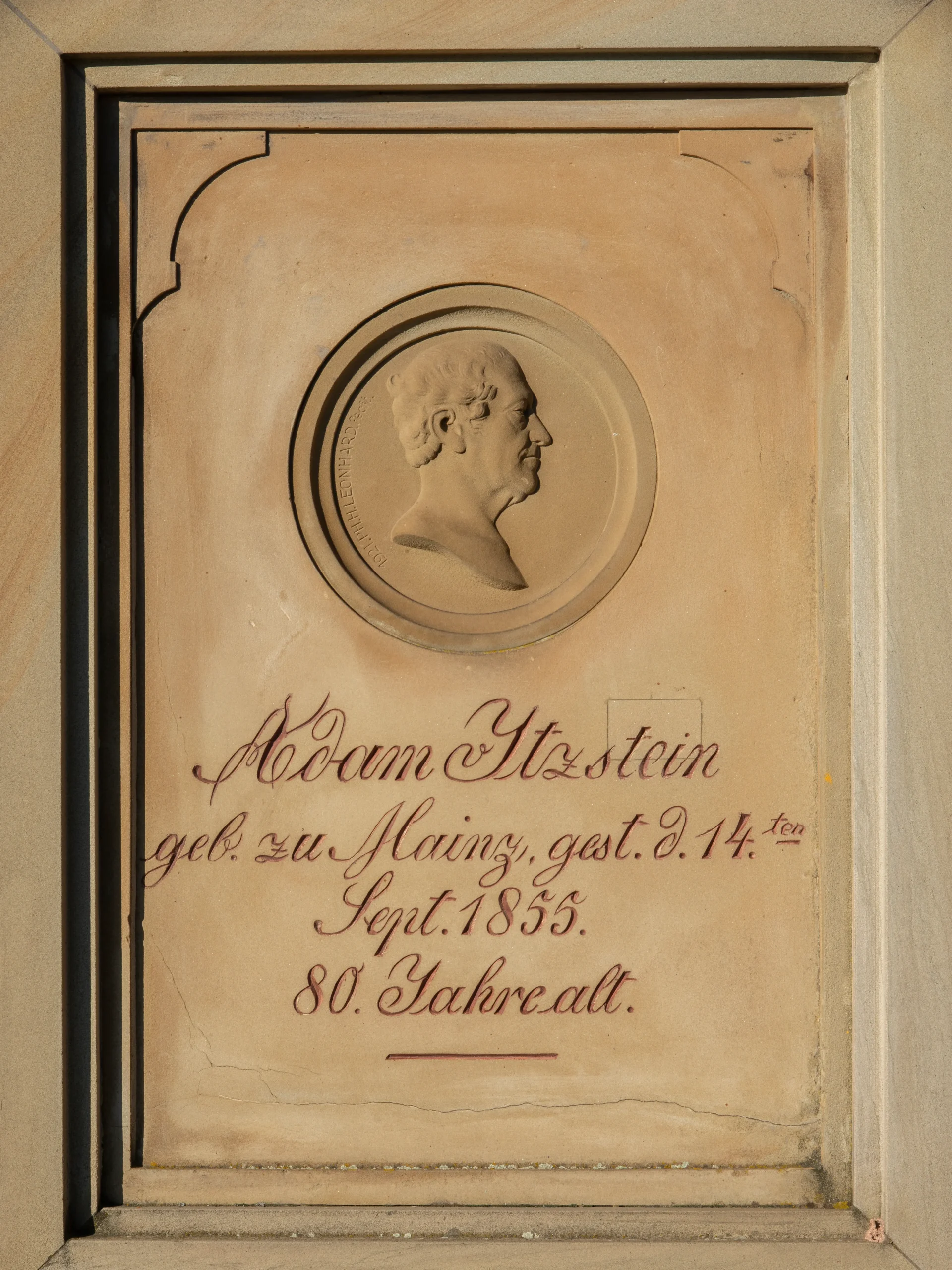 © Uwe Schmolke
© Uwe Schmolke
Grabmal Johann Adam von Itzstein, Oestrich-Winkel

Grabstein von Sophie La Roche an der Aussenmauer der Kirche St. Pankratius
 © E.M.
© E.M.
Sophie von La Roche, Gedenkstein am ehemaligen Wohnhaus, Offenbach am Main
 © Wikimedia Commons/Markus Trienke
© Wikimedia Commons/Markus Trienke
Großer Feldberg / Feldbergturm/ Gedenktafel Feldbergfest
Mehr entdecken - Wissenskarte der KulturRegion
Welche Orte der Industriekultur, der Gartenkunst und der Geschichte von Freiheit und Demokratie sind in der Rhein-Main-Region zu entdecken? Wo sind Museen und Ausstellungen, Kinder- und Jugendtheater, Festspielorte zu finden? Alle bedeutenden kulturellen Orte und Kulturangebote in der Region auf einen Blick ermöglicht die Wissenskarte der KulturRegion.