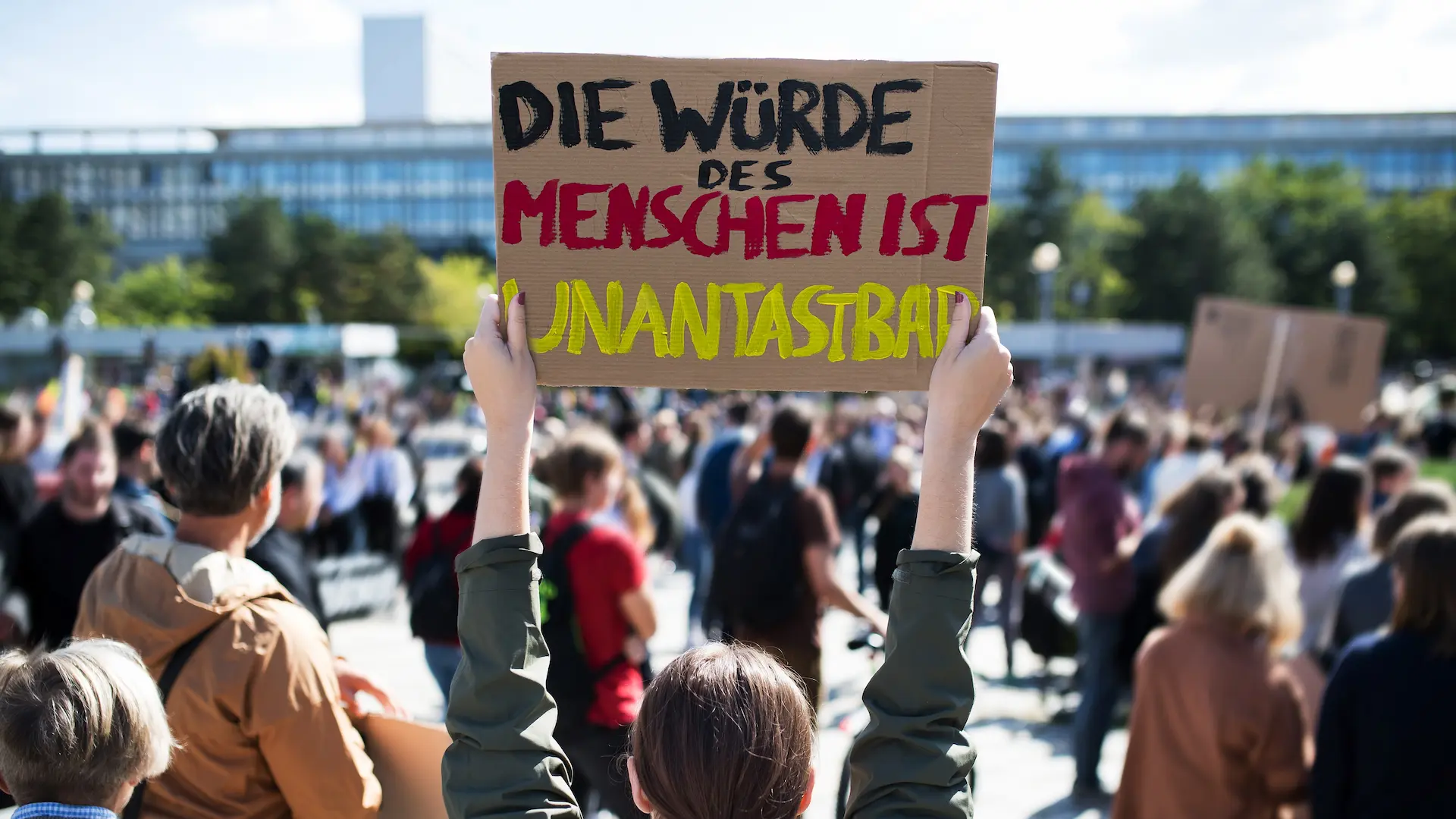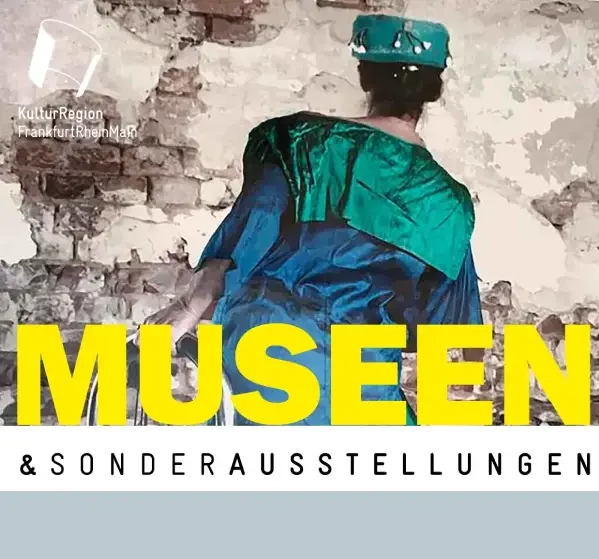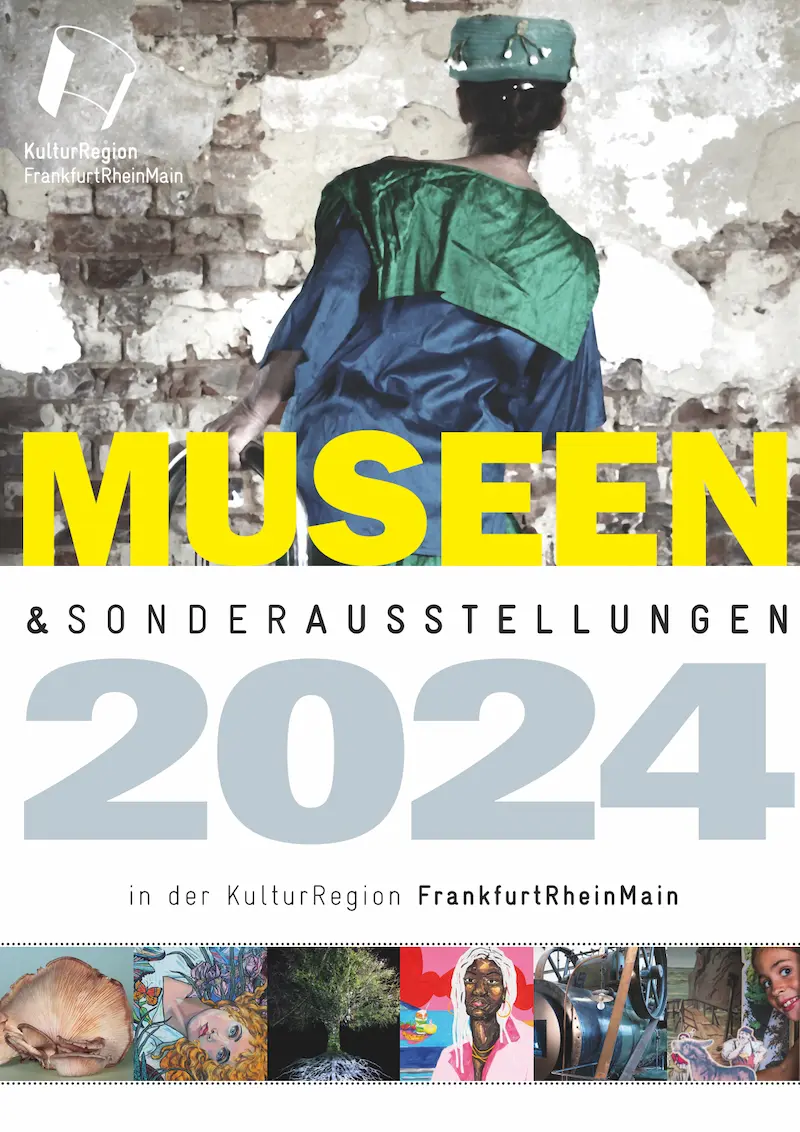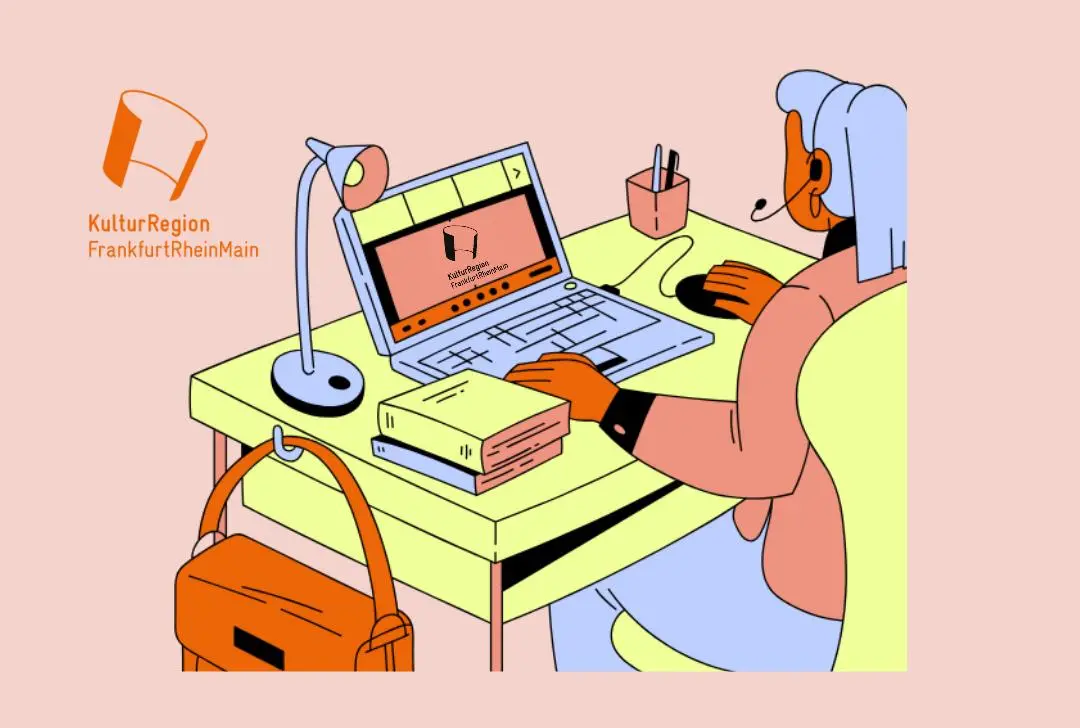(Zufallsauswahl)
 Blick ins Treppenhaus im MGGU © Nils Thies
Blick ins Treppenhaus im MGGU © Nils Thies
Wohnraum. Das Museum als Interieur
01.10.2024 — 29.12.2024 in Frankfurt am Main
 Kubach-Wilmsen, Axis Mundi, 2008/09 Steine aus allen Kontinenten, 520 x 16 x 16 cm © Simone Philippi/Fondation Kubach-Wilmsen
Kubach-Wilmsen, Axis Mundi, 2008/09 Steine aus allen Kontinenten, 520 x 16 x 16 cm © Simone Philippi/Fondation Kubach-Wilmsen
Oberflächen – Untiefen
01.04.2024 — 31.10.2024 in Bad Kreuznach
 Fernsehgerät FS-G von 1955, Design Hans Gugelot. © Braun/P&G
Fernsehgerät FS-G von 1955, Design Hans Gugelot. © Braun/P&G
Lebendige Designgeschichte in der BraunSammlung
02.01.2024 — 22.12.2024 in Kronberg im Taunus
 Lio Houses, Nests, Gönner, cc Internationaler Waldkunstpfad e. V.
Lio Houses, Nests, Gönner, cc Internationaler Waldkunstpfad e. V.
Kinderbauwagen-Saison auf dem Waldkunspfad Darmstadt
03.05.2024, 14:00 Uhr — 27.09.2024, 17:00 Uhr in Darmstadt
 Aïda Muluneh, Star Shine, Moon Glow, 2018; aus der Serie "Water Life". Commissioned by WaterAid and supported by the H&M Found-ation. © Aïda Muluneh
Aïda Muluneh, Star Shine, Moon Glow, 2018; aus der Serie "Water Life". Commissioned by WaterAid and supported by the H&M Found-ation. © Aïda Muluneh
Aïda Muluneh, RAY ECHOES und Martin Parr
02.01.2024 — 30.04.2024 in Frankfurt am Main
 Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH
Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH
Heinrich Siesmayer – Ein Gartenarchitekt erzählt
02.06.2024, 14:00 Uhr in Bad Nauheim
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Fingerhut und Heidenelke – Botanische Wanderung im FFH-Gebiet Schwanheimer Wald
16.06.2024, 11:00 Uhr in Frankfurt am Main
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Hier blüht Ihnen was! Mit Erkenntnis und Spaß zum individuellen Garten(t)raum
04.05.2024, 10:00 Uhr — 05.05.2024, 17:00 Uhr in Stockstadt am Rhein
 Wiesbaden Kinderrechte-Denkmal © Wikimedia
Wiesbaden Kinderrechte-Denkmal © Wikimedia
Wir haben Rechte!
22.05.2024, 10:00 Uhr in Frankfurt am Main