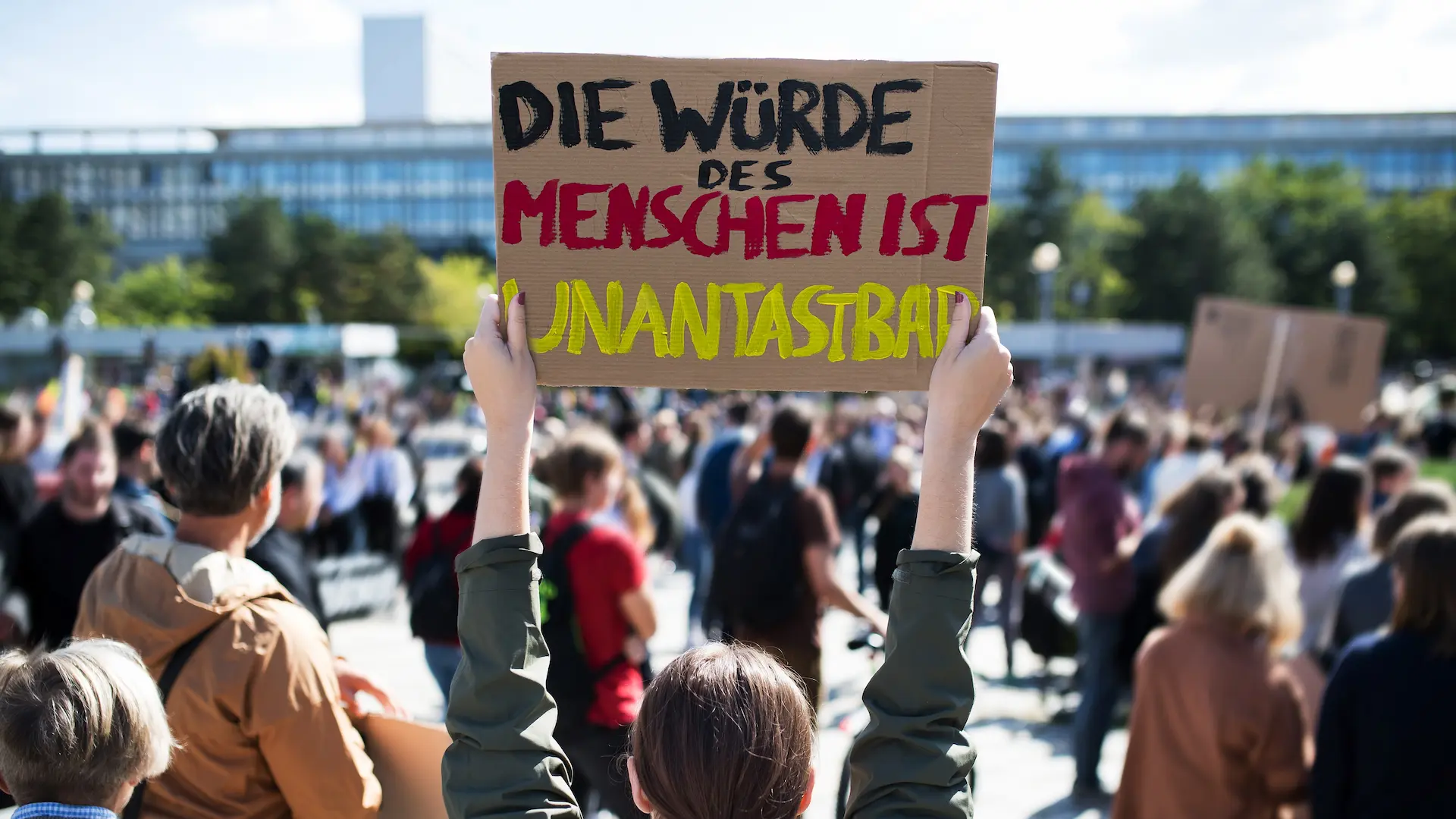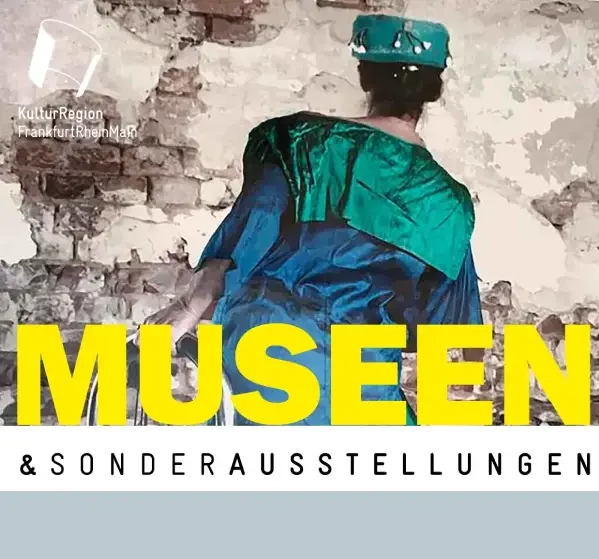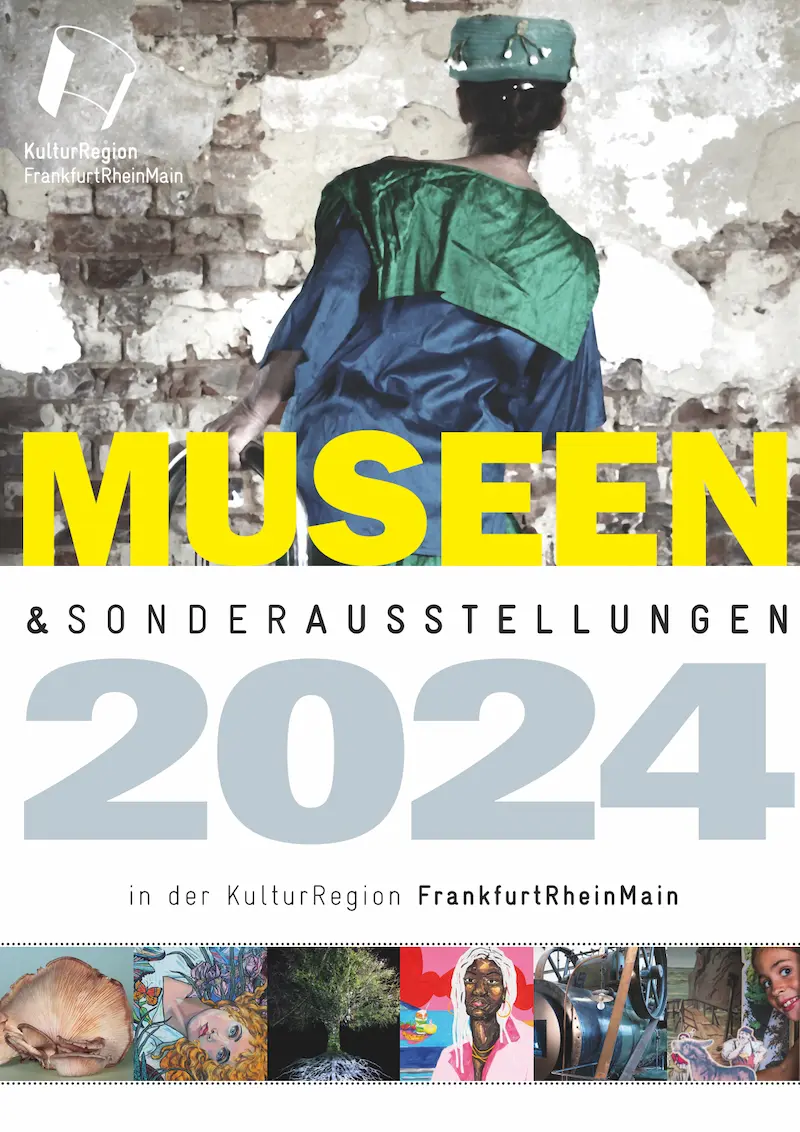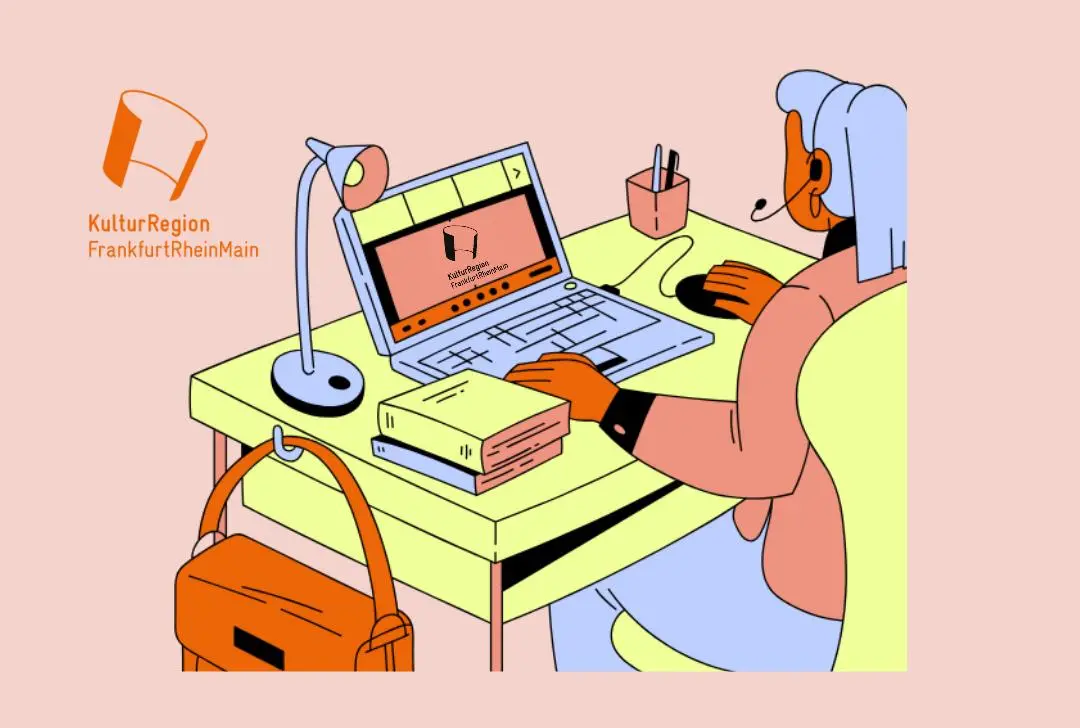(Zufallsauswahl)
 Palmengarten, Hilke Steinecke
Palmengarten, Hilke Steinecke
Eindrücke einer botanischen Sammelreise nach Chile
12.05.2024, 11:00 Uhr in Frankfurt am Main
 Sieglinde Gros, Fülle, Ahorn farbig gefasst, 2018 © Sieglinde Gros
Sieglinde Gros, Fülle, Ahorn farbig gefasst, 2018 © Sieglinde Gros
Sieglinde Gros – Zwiesprachen
18.08.2024 — 29.09.2024 in Dieburg
 Sybille Fuchs
Sybille Fuchs
12. Pflanzentauschbörse & Urban Gardening Aktionstag
04.05.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main
 Christian Bandy
Christian Bandy
Edelkastanien-Wanderung zur Blütezeit – Geführter Spaziergang
22.06.2024, 14:00 Uhr in Königstein im Taunus
 © Stefanie Kösling
© Stefanie Kösling
„So zieht die Freiheit durch alle Lande“ – Theateraktion zum 175. Jubiläum der Revolution 1848/49 in Rüsselsheim
11.05.2024, 11:00 Uhr
 Skulpturengarten Darmstadt
Skulpturengarten Darmstadt
Lebenselixier Skulpturengarten
19.05.2024, 14:30 Uhr in Skulpturengarten Darmstadt
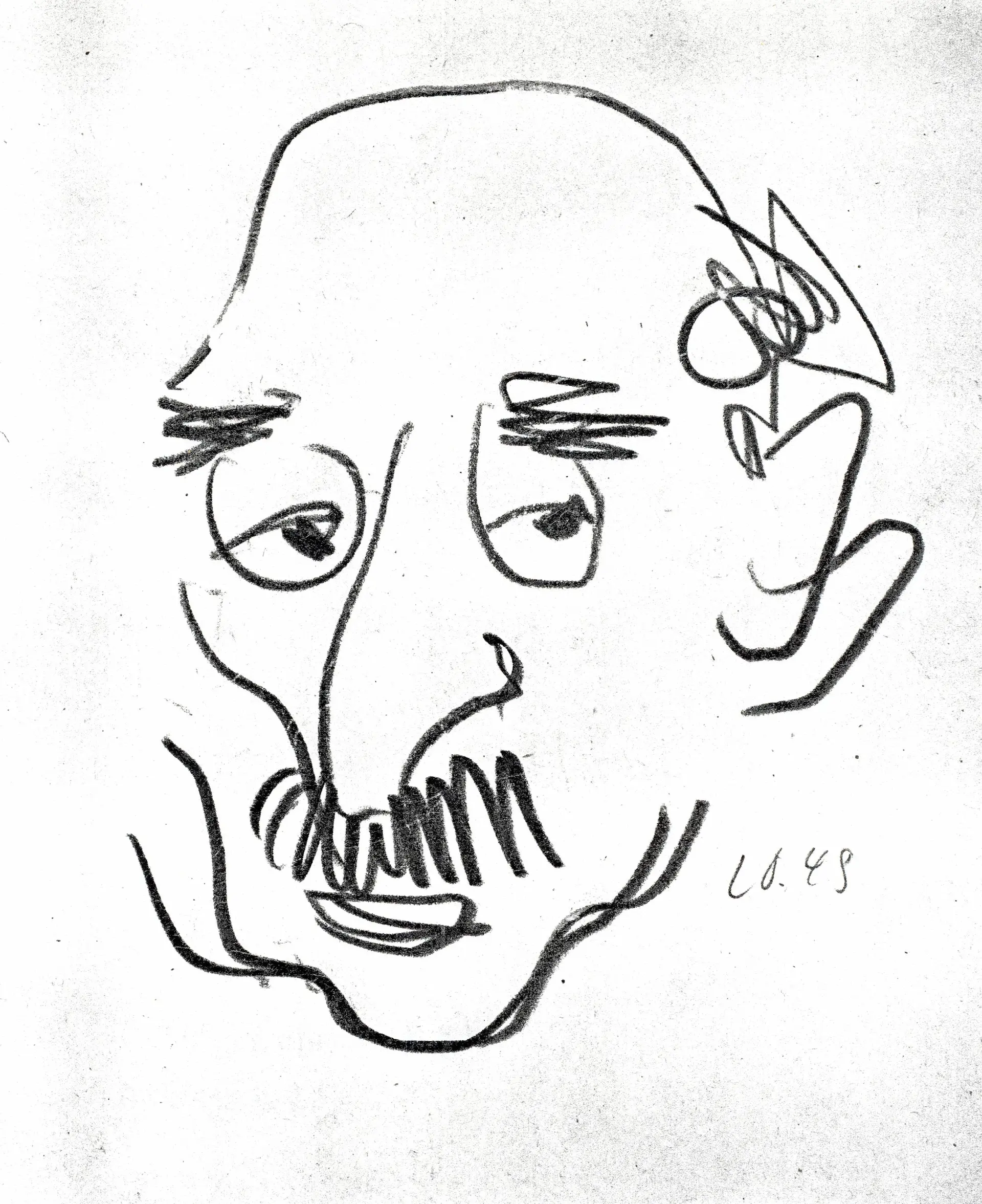 © Bergsträsser: HStAD, R 4, Nr. 12336
© Bergsträsser: HStAD, R 4, Nr. 12336
Politik ist Praxis, nicht Illusion. Das politische Leben und Wirken des Sozialdemokraten Ludwig Bergsträsser (1883-1960)
21.11.2024, 18:00 Uhr in Darmstadt
 Aïda Muluneh, Star Shine, Moon Glow, 2018; aus der Serie "Water Life". Commissioned by WaterAid and supported by the H&M Found-ation. © Aïda Muluneh
Aïda Muluneh, Star Shine, Moon Glow, 2018; aus der Serie "Water Life". Commissioned by WaterAid and supported by the H&M Found-ation. © Aïda Muluneh
Aïda Muluneh, RAY ECHOES und Martin Parr
02.01.2024 — 30.04.2024 in Frankfurt am Main
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Spaziergang durch den Heinrich- Kraft-Park – Ein Waldspielpark im neuen Gewand
23.06.2024, 11:00 Uhr in Frankfurt am Main