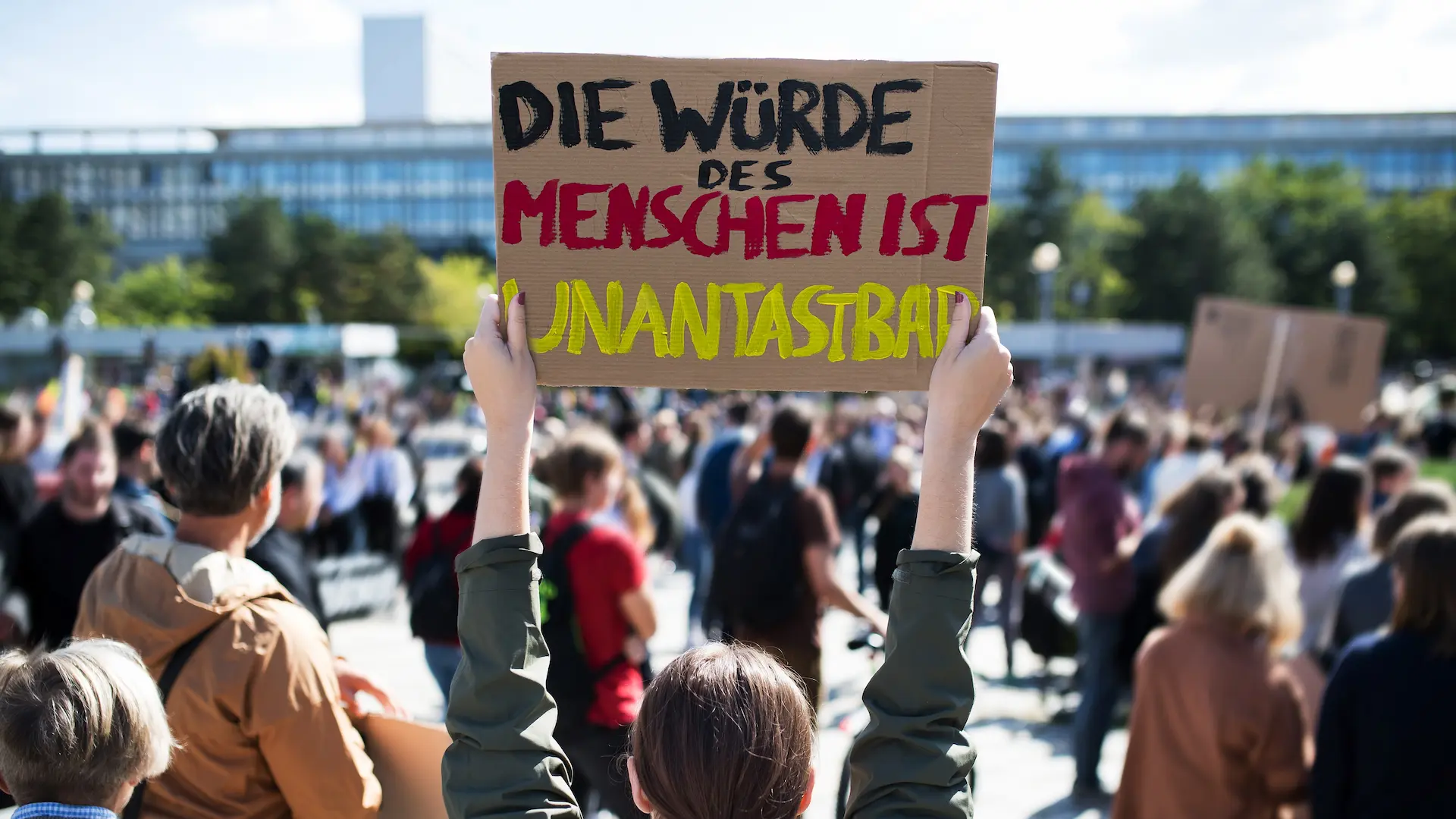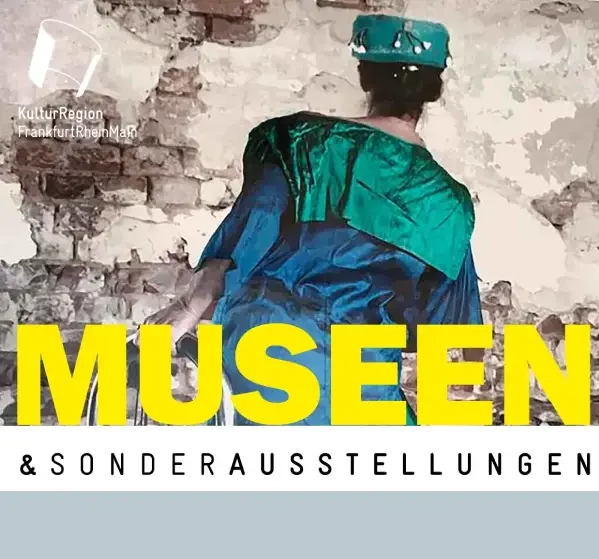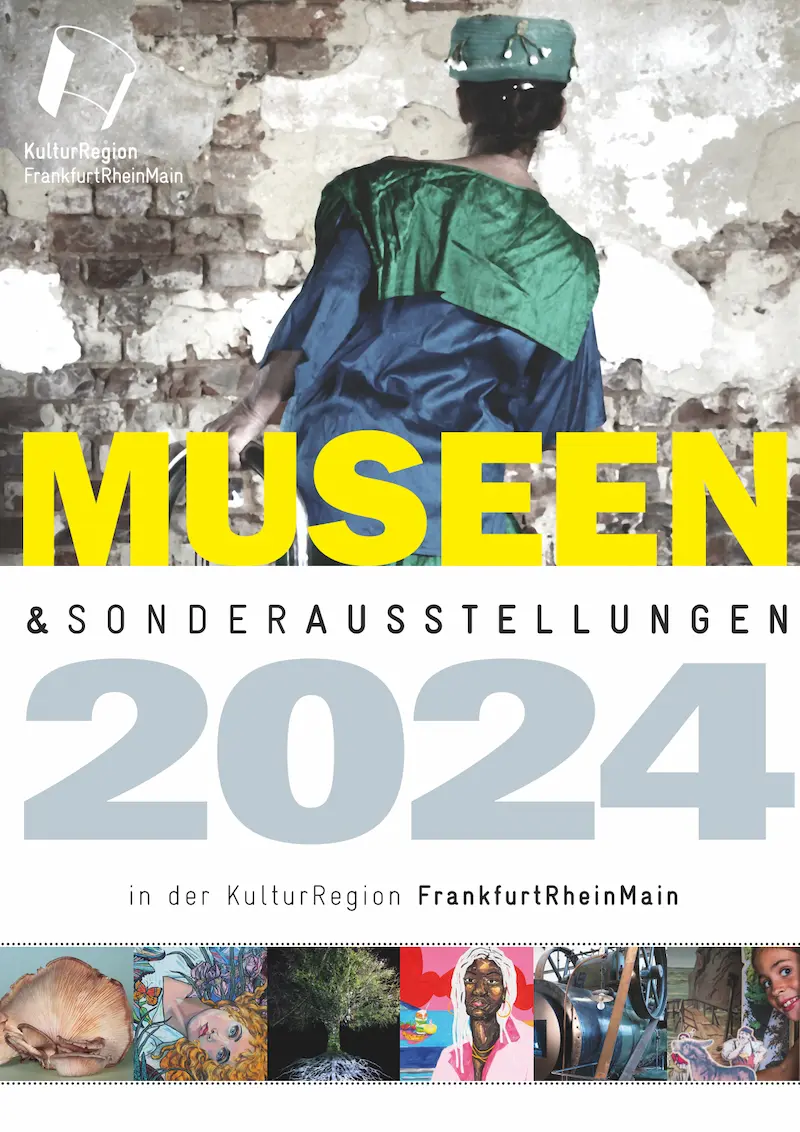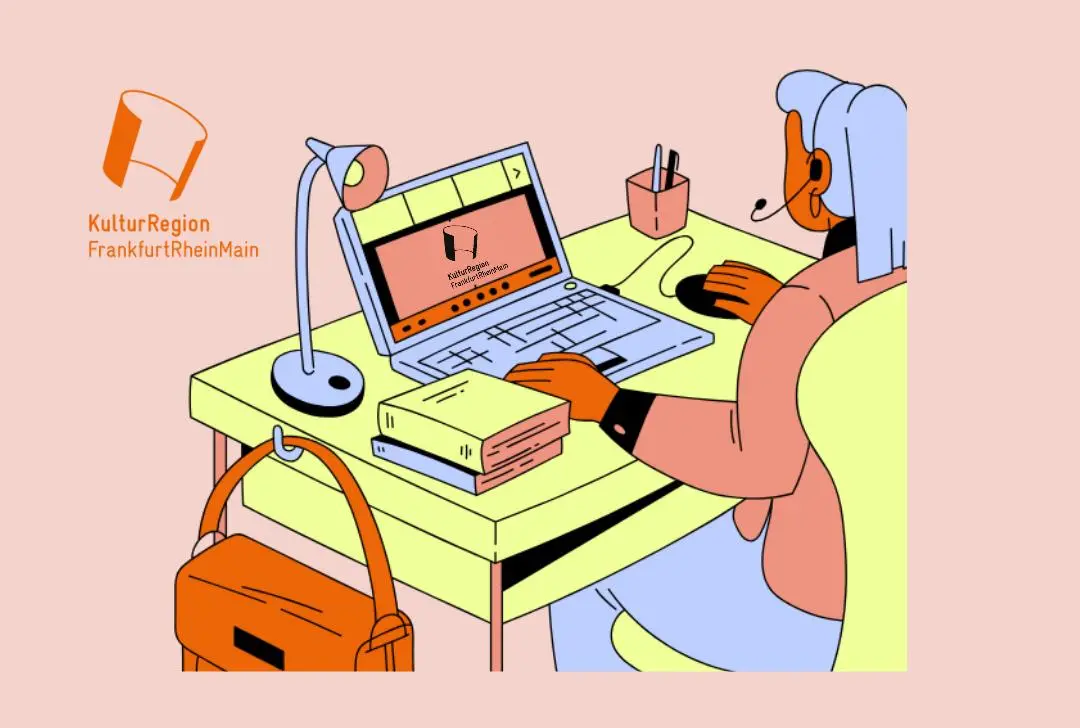(Zufallsauswahl)
 Frank Möllenberg
Frank Möllenberg
Romantischer Verna-Park. Lyrische Parkführung
23.06.2024, 11:00 Uhr in Rüsselsheim am Main
 Botanischer Garten Frankfurt
Botanischer Garten Frankfurt
Shakespeare und die Pflanzen
08.06.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Offene Gärten Oberes Weiltal und Umgebung
26.05.2024, 11:00 Uhr in Hochtaunuskreis
 Schneckenhörner aus Neuguinea und von der Molukken-Insel Seram. Sammlung Weltkulturen Museum © Wolfgang Günzel
Schneckenhörner aus Neuguinea und von der Molukken-Insel Seram. Sammlung Weltkulturen Museum © Wolfgang Günzel
Klangquellen. Everything is Music!
03.01.2024 — 01.10.2024 in Frankfurt am Main
 Palmengarten, Hilke Steinecke
Palmengarten, Hilke Steinecke
Eindrücke einer botanischen Sammelreise nach Chile
12.05.2024, 11:00 Uhr in Frankfurt am Main
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
"Stell dir vor, du wärst ein Tier im Wald" - Einen Lebensraum mit Büchern erkunden
05.05.2024, 13:00 Uhr
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Wilde Tiere mitten in der Stadt
28.06.2024, 18:00 Uhr in Offenbach am Main
 pixabay_Alexa
pixabay_Alexa
Bienen im Jahresverlauf – Waren die Bienen fleißig?
30.06.2024, 10:00 Uhr in Stockstadt am Rhein
 Die Frauenfiguren von Otto Glenz sind deutlich dem Jugenstil zuzuordnen © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel
Die Frauenfiguren von Otto Glenz sind deutlich dem Jugenstil zuzuordnen © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel
Themenjahr: Frauen stehen im Fokus des Deutschen Elfenbeinmuseums
01.03.2024 — 31.12.2024