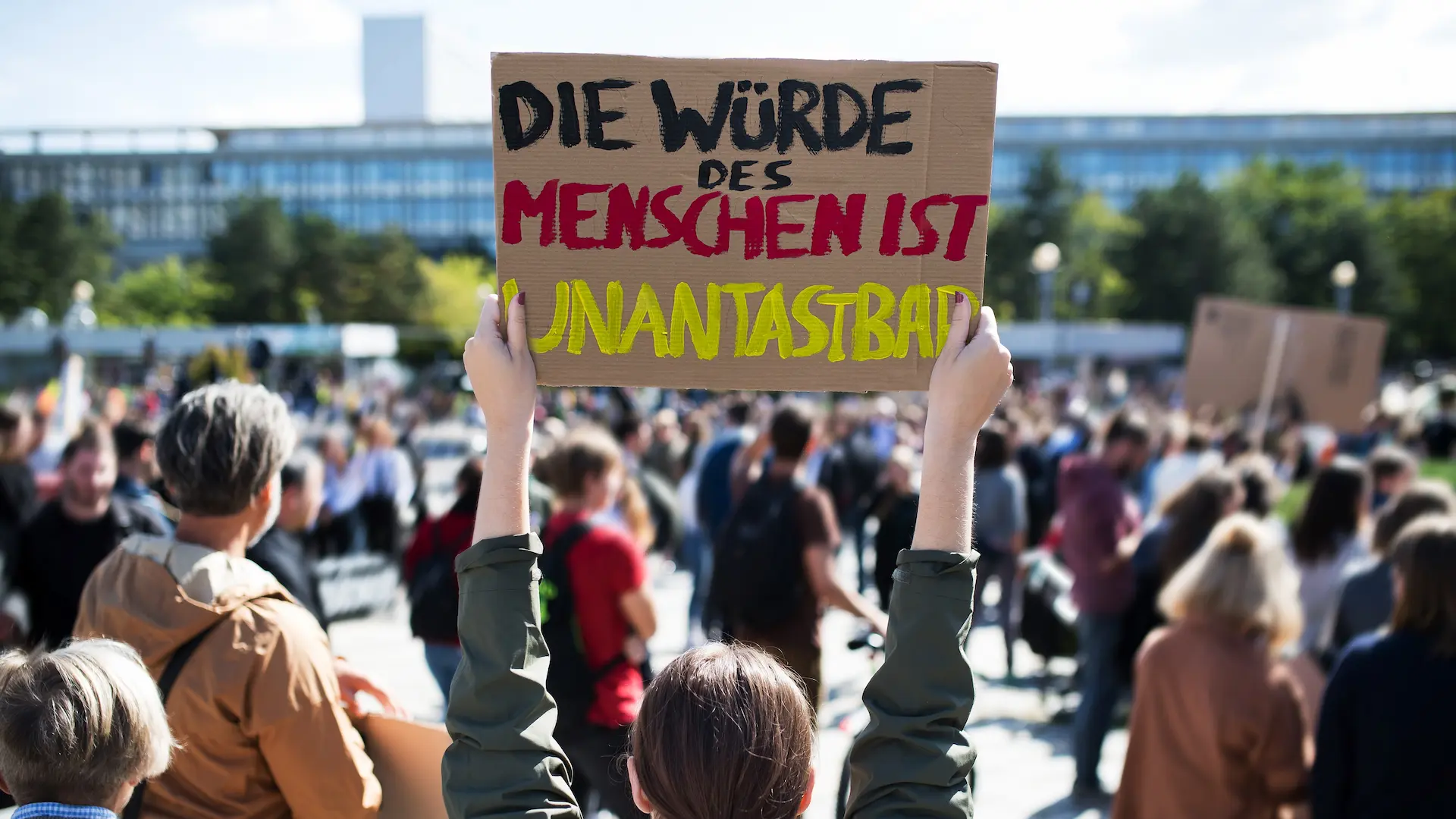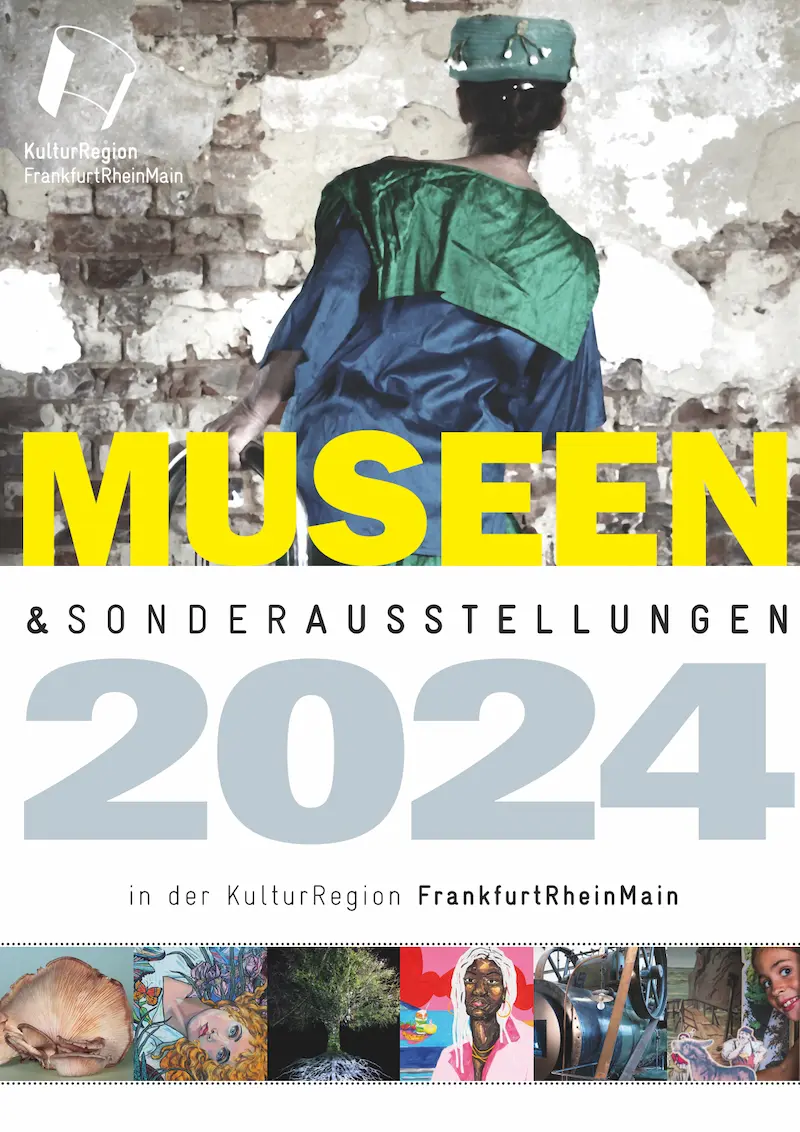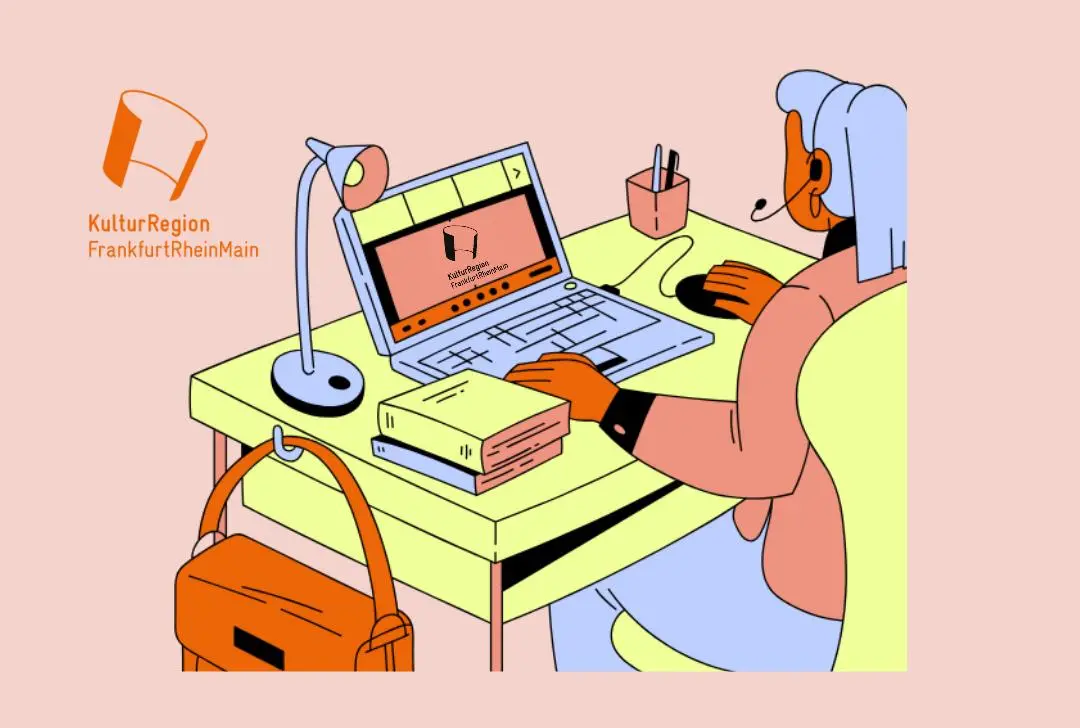(Zufallsauswahl)
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Vogel-Beringung
25.05.2024, 05:30 Uhr in Frankfurt am Main
 Cartoon Greser & Lenz © Greser & Lenz, F.A.Z.
Cartoon Greser & Lenz © Greser & Lenz, F.A.Z.
Homo sapiens raus! Heimspiel für Greser & Lenz
17.03.2024 — 18.08.2024 in Aschaffenburg
 © Stefanie Kösling
© Stefanie Kösling
„So zieht die Freiheit durch alle Lande“ – Theateraktion zum 175. Jubiläum der Revolution 1848/49 in Eltville am Rhein
31.10.2024, 17:00 Uhr in Eltville am Rhein
 Stefanie Wetzel
Stefanie Wetzel
Reimers Garten in der Sommerblüte
19.06.2024, 19:00 Uhr in Bad Homburg vor der Höhe
 © Fotoarchiv Magistrat der Stadt Eltville am Rhein
© Fotoarchiv Magistrat der Stadt Eltville am Rhein
GartenRheinMain-Fokusreihe „Mit allen Sinnen“: Kunst, Geschichte und Genuss
03.09.2024, 17:30 Uhr in Eltville am Rhein
 Architekturen und Kopf © Hans Otto Lohrengel
Architekturen und Kopf © Hans Otto Lohrengel
Hans Otto Lohrengel: Neue Bildwelten. Fotokollagen und Skulpturen
03.01.2024 — 01.05.2024 in Seeheim-Jugenheim
 Rudolf Schramm-Zittau, Blick auf die Zeil von der Hauptwache aus, Frankfurt am Main, um 1911, Gemälde, Öl auf Leinwand © HMF/Horst Ziegenfusz
Rudolf Schramm-Zittau, Blick auf die Zeil von der Hauptwache aus, Frankfurt am Main, um 1911, Gemälde, Öl auf Leinwand © HMF/Horst Ziegenfusz
Bewegung! Frankfurt und die Mobilität
21.11.2024 — 31.03.2025 in Frankfurt am Main
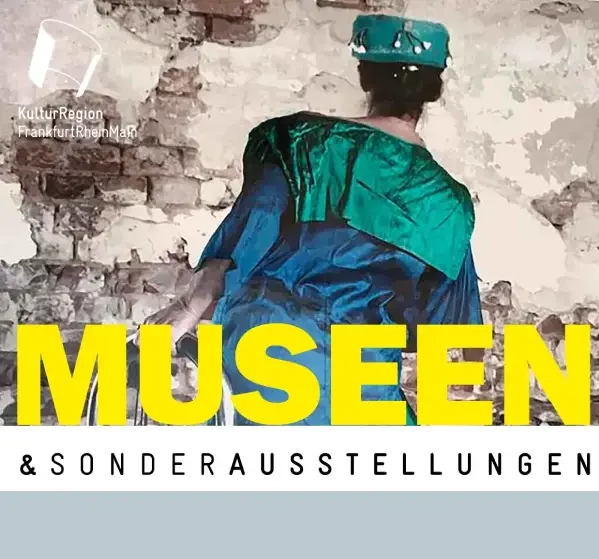 © Elfie Eckart, Kunstverein Aschaffenburg/pitze Eckart
© Elfie Eckart, Kunstverein Aschaffenburg/pitze Eckart
Geld in Karikatur und Satire
02.01.2024 — 04.05.2024 in Frankfurt am Main
 Arnika Haury
Arnika Haury
Kräuterführung zum Natur-Kneipp-Becken
01.06.2024, 11:00 Uhr in Büdingen