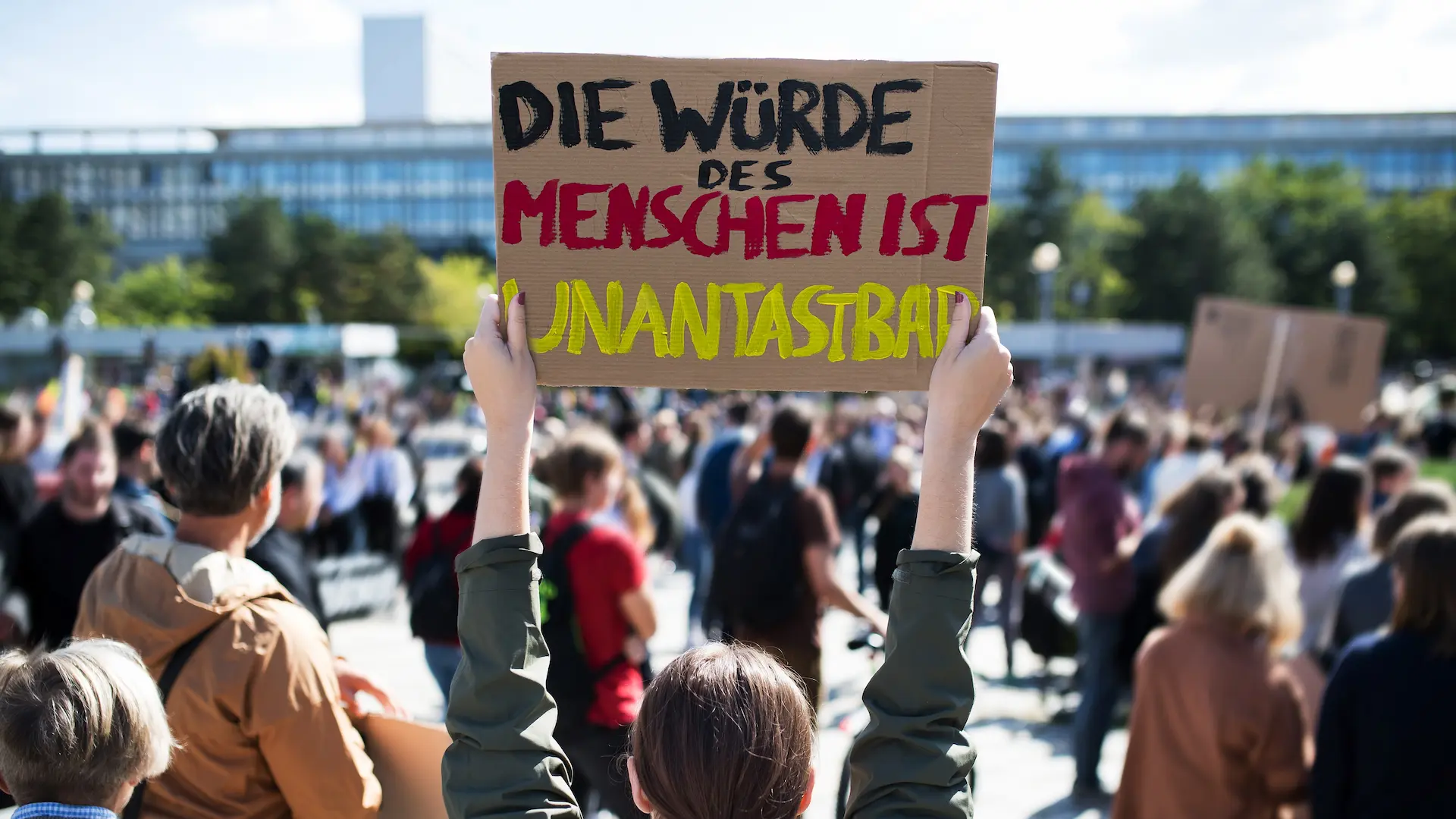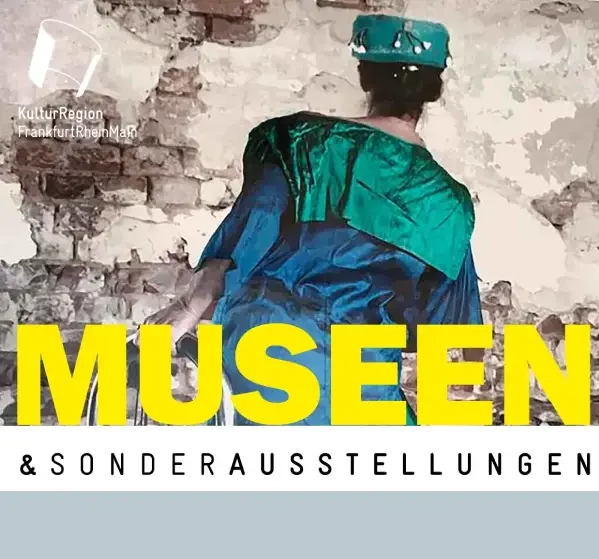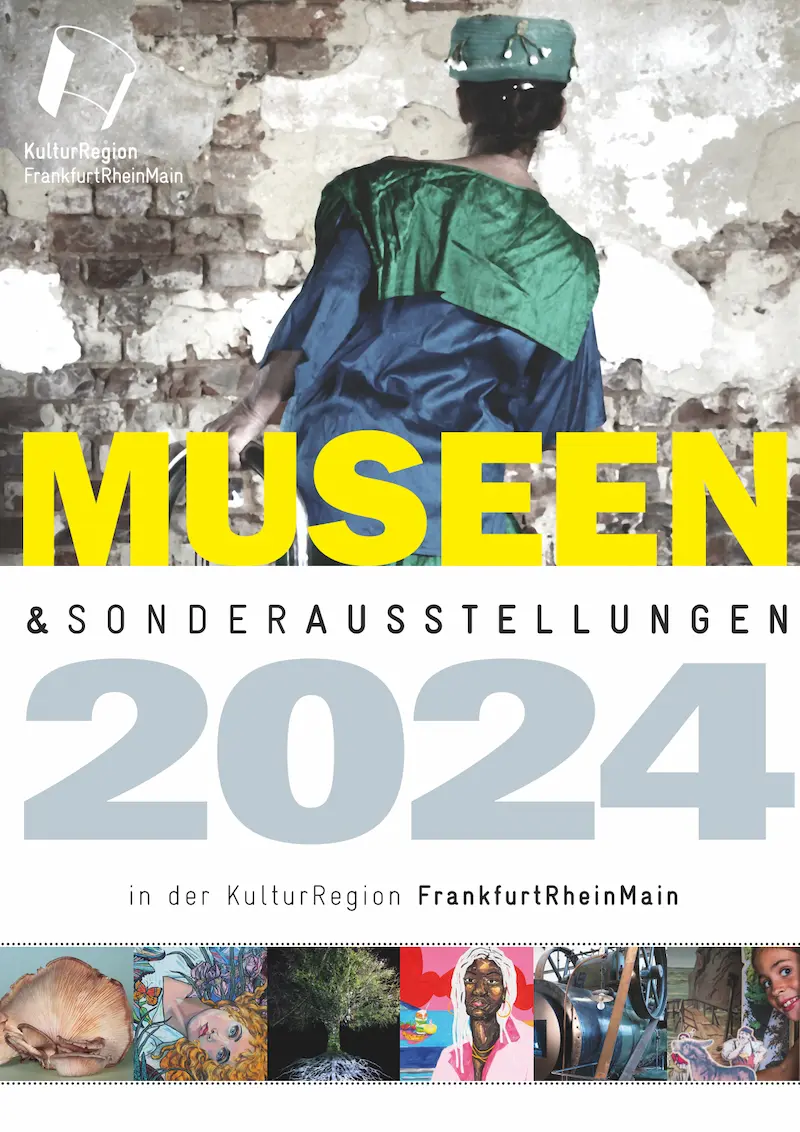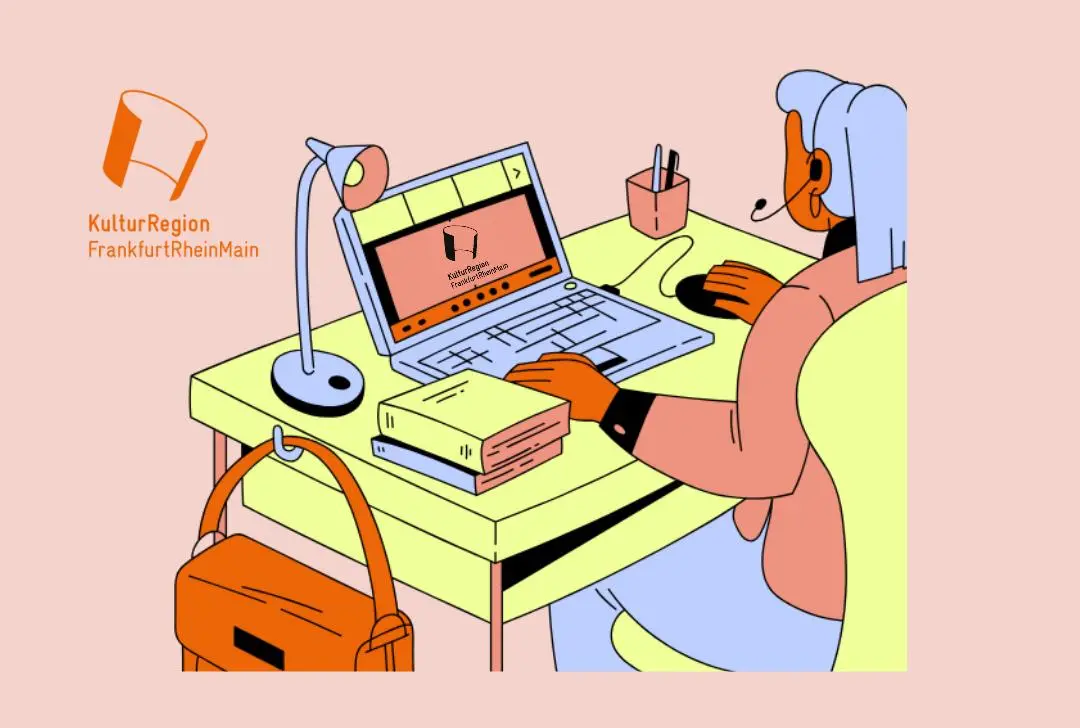(Zufallsauswahl)
 pixabay_lapping
pixabay_lapping
Historischer Spaziergang durch den Grüneburgpark
06.06.2024, 15:00 Uhr in Frankfurt am Main
 Foto und variables Wand-Schmuck-Objekt „Farbfunde“. 2023. Eloxaldruck, Acrylglas, Edelstahl, Magnete © Eunok Cho
Foto und variables Wand-Schmuck-Objekt „Farbfunde“. 2023. Eloxaldruck, Acrylglas, Edelstahl, Magnete © Eunok Cho
Elisabeth Holder Vom Schmuck zur kontextuellen Kunst
21.04.2024 — 25.08.2024 in Hanau
 Modell eines Messeler Urpferdchens © Welterbe Grube Messel/Lukardis Wencker
Modell eines Messeler Urpferdchens © Welterbe Grube Messel/Lukardis Wencker
Die Kunst der Evolution. Urpferd gestern – heute - morgen
22.03.2024 — 22.12.2024 in Messel
 Detailaufnahme des Schöllenbacher Altars © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel
Detailaufnahme des Schöllenbacher Altars © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel
Die Gräflichen Sammlungen von Schloss Erbach
01.03.2024 — 31.12.2024
 Kunsthandlung Osper
Kunsthandlung Osper
Sommerausstellung Hannes Helmke: Von Mensch zu Mensch
15.06.2024 — 06.10.2024 in Eschborn
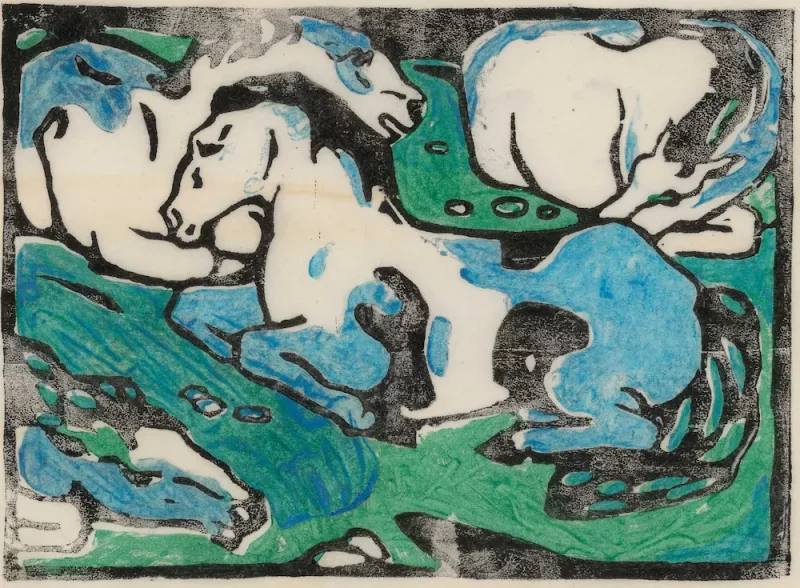 Franz Marc, Ruhende Pferde, 1911/12, Farbholzschnitt © Privatsammlung/Georgios Michaloudis
Franz Marc, Ruhende Pferde, 1911/12, Farbholzschnitt © Privatsammlung/Georgios Michaloudis
Das Tier in der Kunst des Expressionismus
21.09.2024 — 19.01.2025 in Aschaffenburg
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Offene Gartenpforte
16.06.2024, 14:00 Uhr in Dieburg
 Stephanie Heeg-El-Sayed
Stephanie Heeg-El-Sayed
Hauptfriedhof – Landschaftsgarten und Ort der Stille
16.06.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main
 BIEGL e.V.
BIEGL e.V.
Tag der offenen Gärten in der Grünen Lunge
16.06.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main