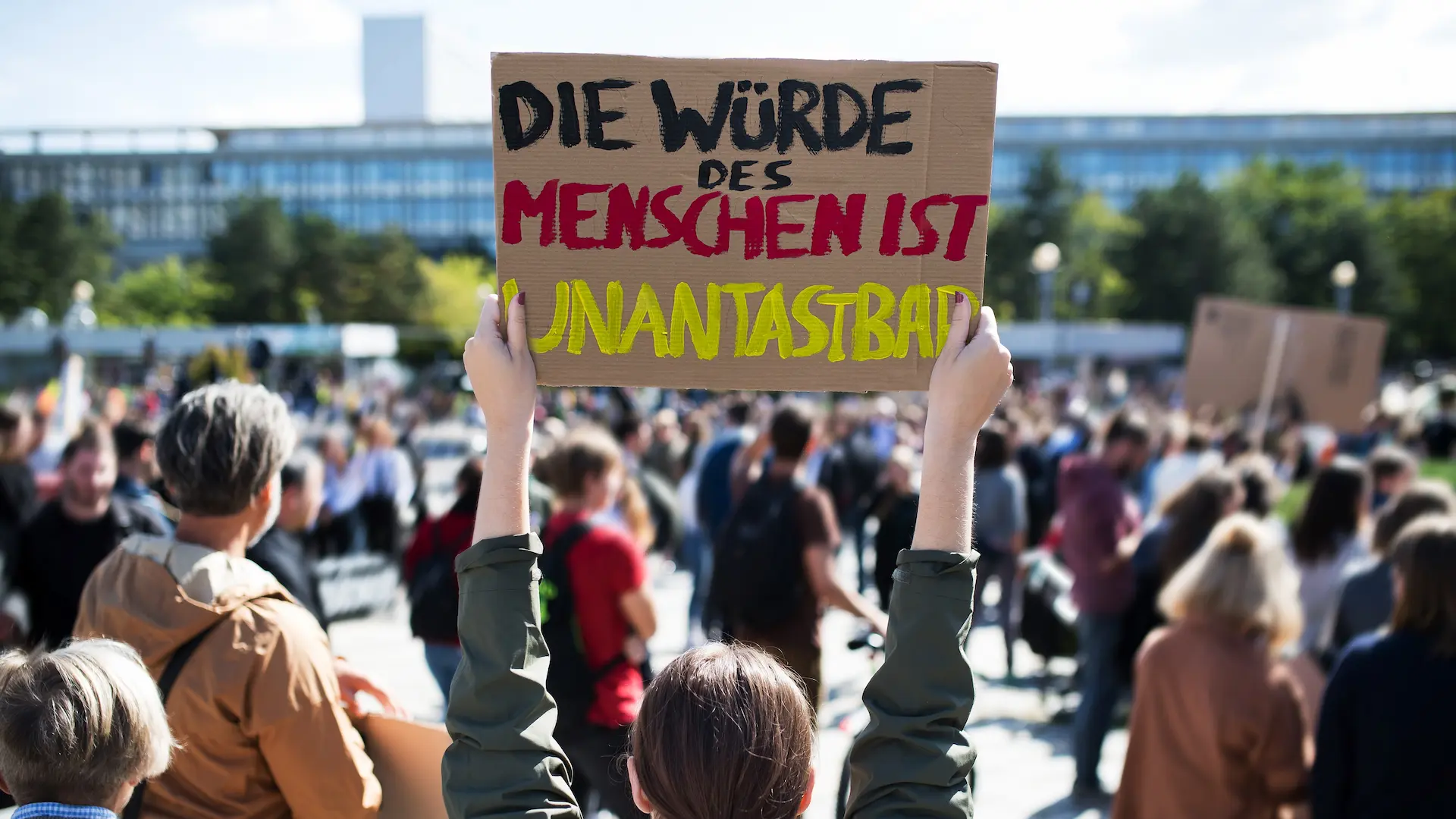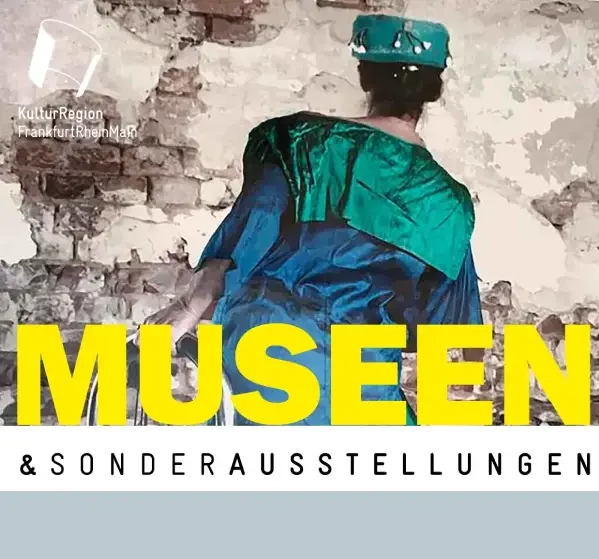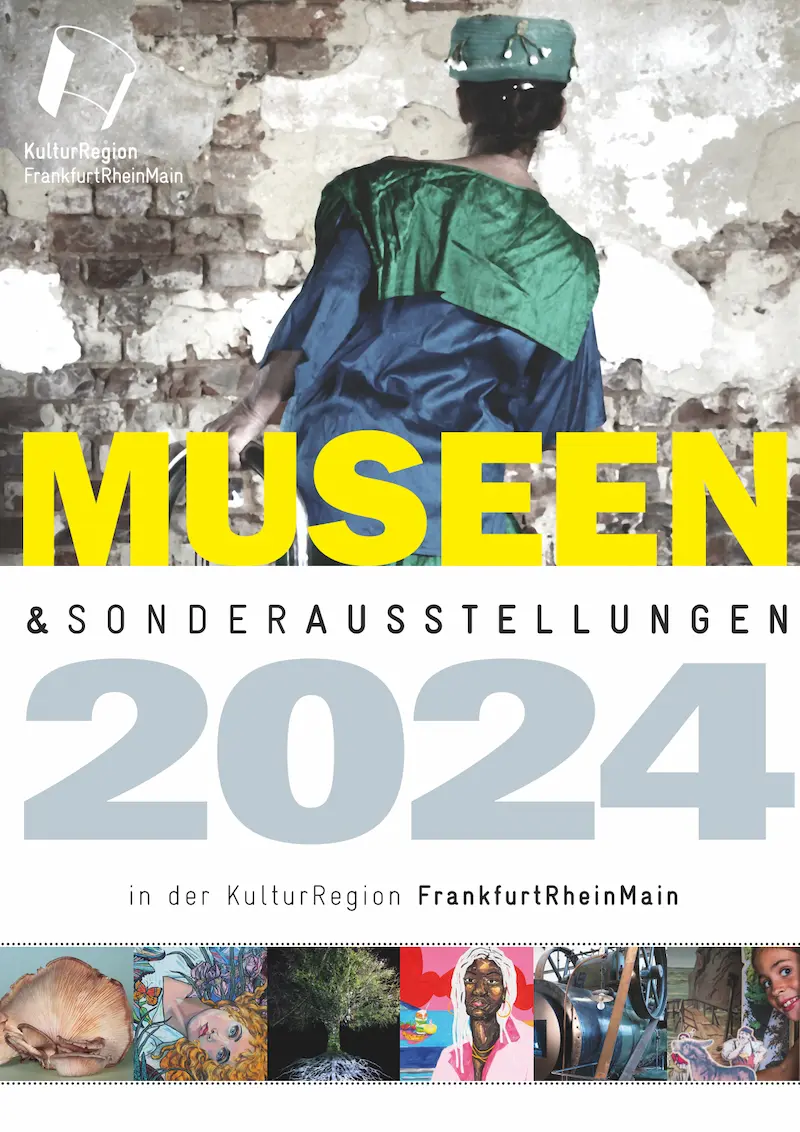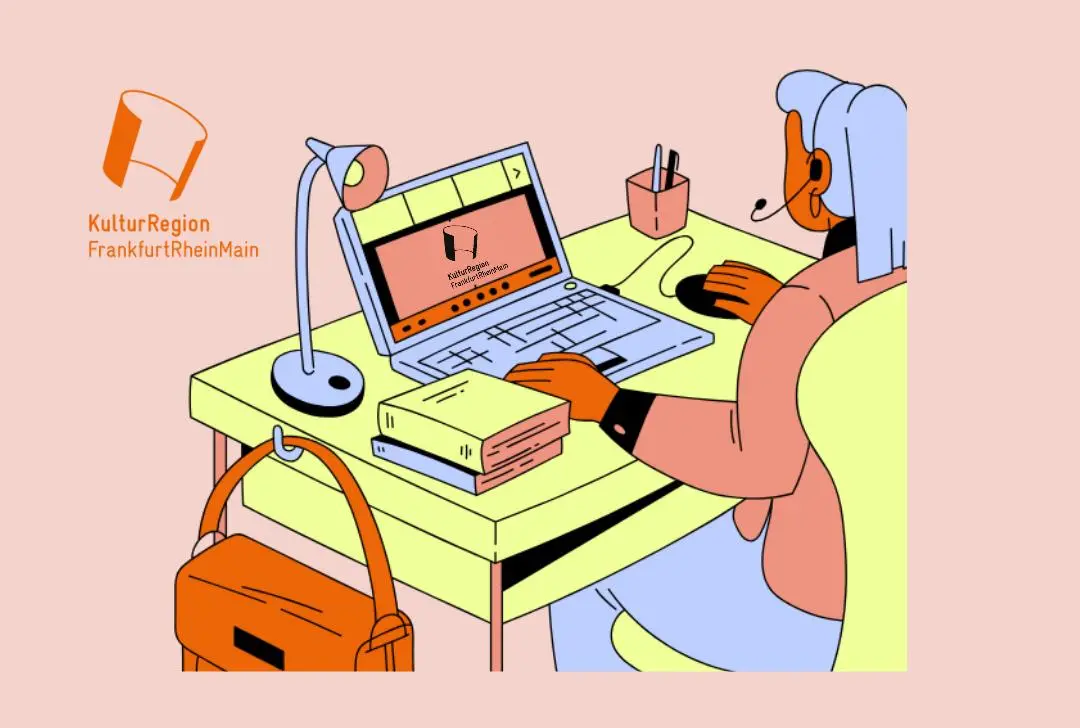(Zufallsauswahl)
 pixabay_Couleur
pixabay_Couleur
Sommerkräuter für die Gesundheit und den Speisezettel
14.06.2024, 16:00 Uhr in Bad Soden am Taunus
 Sybille Fuchs
Sybille Fuchs
12. Pflanzentauschbörse & Urban Gardening Aktionstag
04.05.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main
 Blick auf den Polygonalen Turm und Gewölbe. © Städtische Museen Hanau
Blick auf den Polygonalen Turm und Gewölbe. © Städtische Museen Hanau
Burggeschichte(n) Begleitausstellung zu Grabungen im Zwinger Schloss Steinheim
06.01.2024 — 29.12.2024 in Hanau
 Ina Bierstedt, Tarndecke, 2020 © Ina Bierstedt
Ina Bierstedt, Tarndecke, 2020 © Ina Bierstedt
Ina Bierstedt + Anna Holzhauer, 1:1 – Hinderniswolken
12.09.2024 — 20.10.2024 in Wiesbaden
 Stephanie Heeg-El-Sayed
Stephanie Heeg-El-Sayed
Die letzte Generation der Wälder
04.05.2024, 15:00 Uhr in Wiesbaden
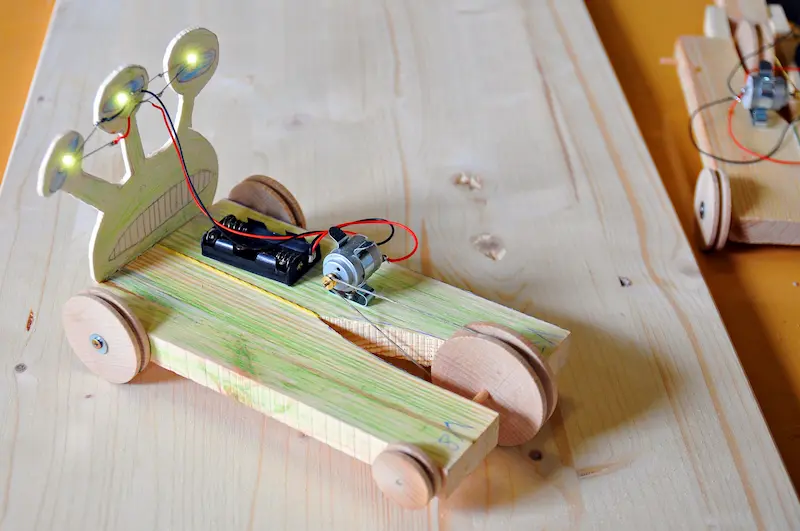 © Kai Wolf
© Kai Wolf
Fantasie-Fahrzeuge
30.08.2024, 15:00 Uhr in Hattersheim am Main
 Samurai-Helm, Japan, um 1860 (Edo-Zeit) © DLM/L. Brichta
Samurai-Helm, Japan, um 1860 (Edo-Zeit) © DLM/L. Brichta
DAS IST LEDER! Von A bis Z
03.01.2024 — 22.12.2024 in Offenbach am Main
 Speisesaal im Englischen Flügel des Schlosses © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel
Speisesaal im Englischen Flügel des Schlosses © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel
Schloss und Schlosspark Bad Homburg
01.01.2024 — 31.12.2024 in Bad Homburg vor der Höhe
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Naturforscherwerkstatt – Von Bienen und ihren wilden Schwestern
28.04.2024, 14:00 Uhr in Stockstadt am Rhein