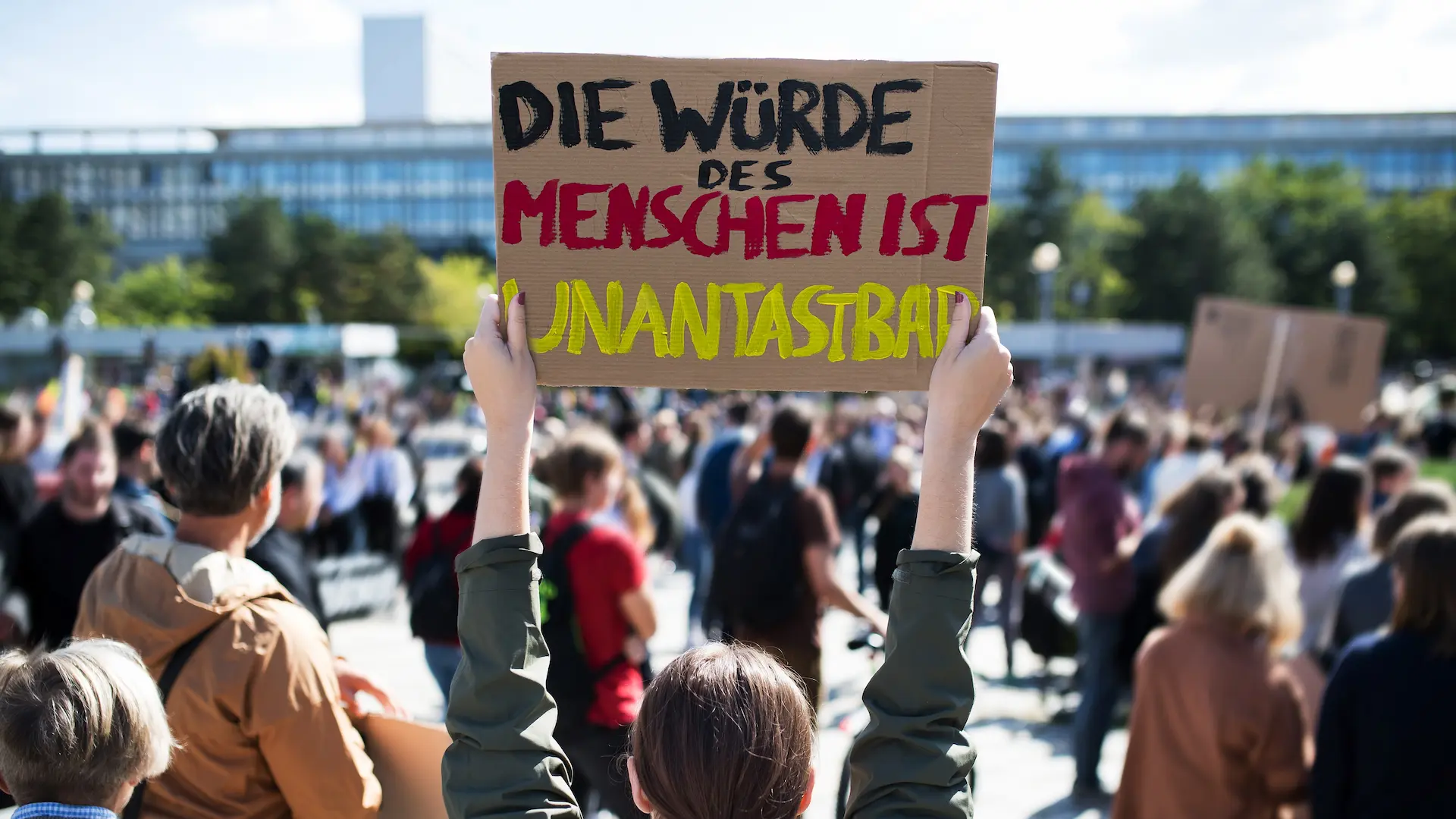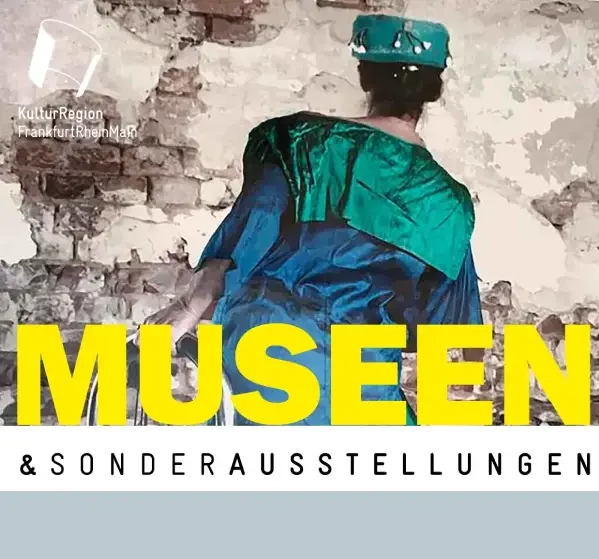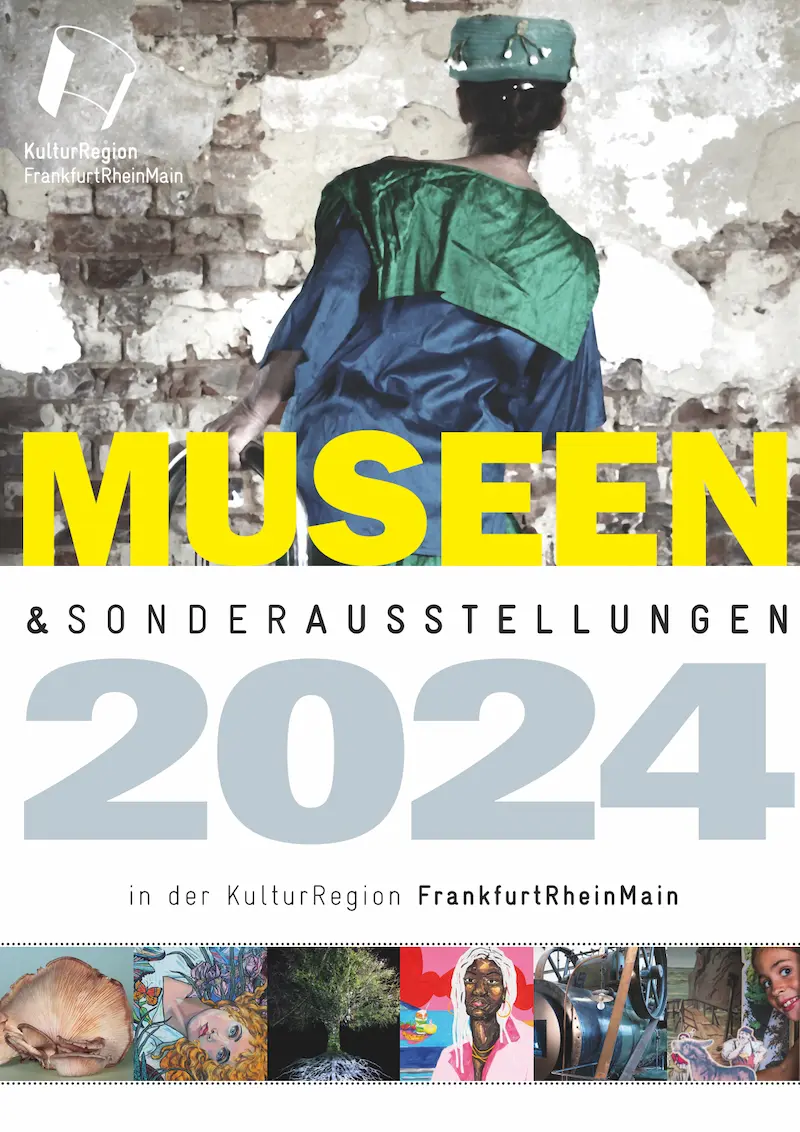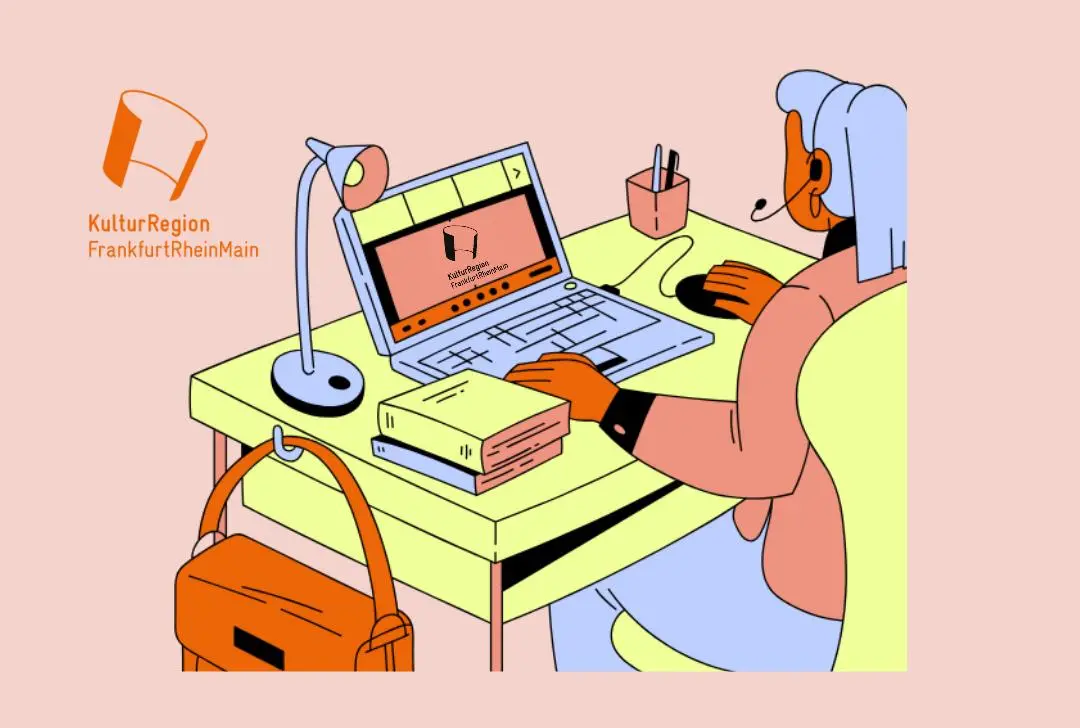(Zufallsauswahl)
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Vogelbeobachtungen im Kirdorfer Feld
05.05.2024, 07:00 Uhr in Bad Homburg vor der Höhe
 Förderverein Oberursel (Ts.)
Förderverein Oberursel (Ts.)
Frühlingserwachen im Schulwald
04.05.2024, 11:00 Uhr in Oberursel (Taunus)
 Christian Bandy
Christian Bandy
Der Kraftstrauß – Geführter Spaziergang
16.06.2024, 15:00 Uhr in Königstein im Taunus
 Marcus Stiehl
Marcus Stiehl
Poesie am Wegesrand – Wege zur Poesie
25.05.2024, 16:00 Uhr in Laubach
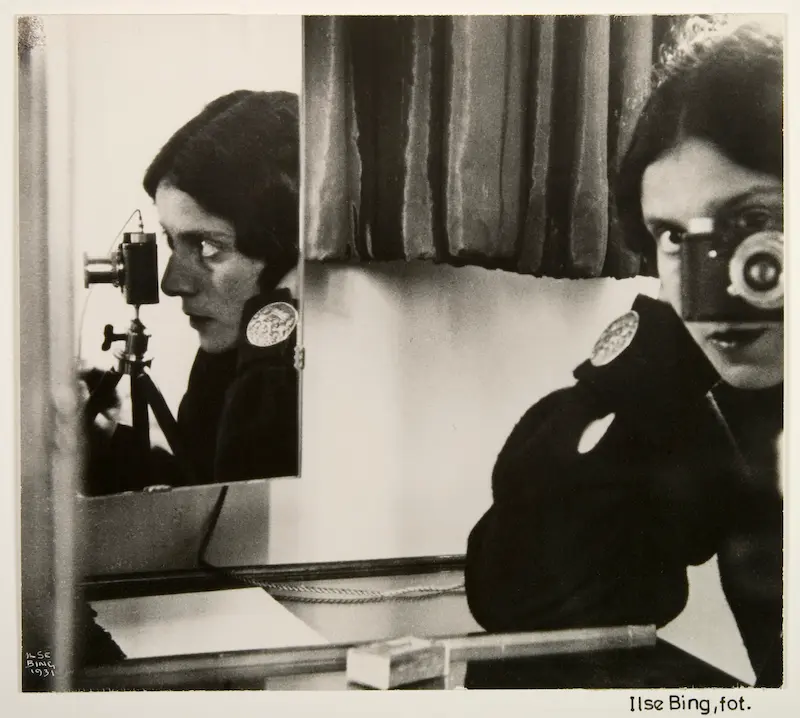 Ilse Bing, Selbstporträt mit Leica im Spiegel, Frankfurt 1931 © HMF/Moritz Bernoully
Ilse Bing, Selbstporträt mit Leica im Spiegel, Frankfurt 1931 © HMF/Moritz Bernoully
Stadt der Fotografinnen. Frankfurt 1844–2024
29.05.2024 — 22.09.2024 in Frankfurt am Main
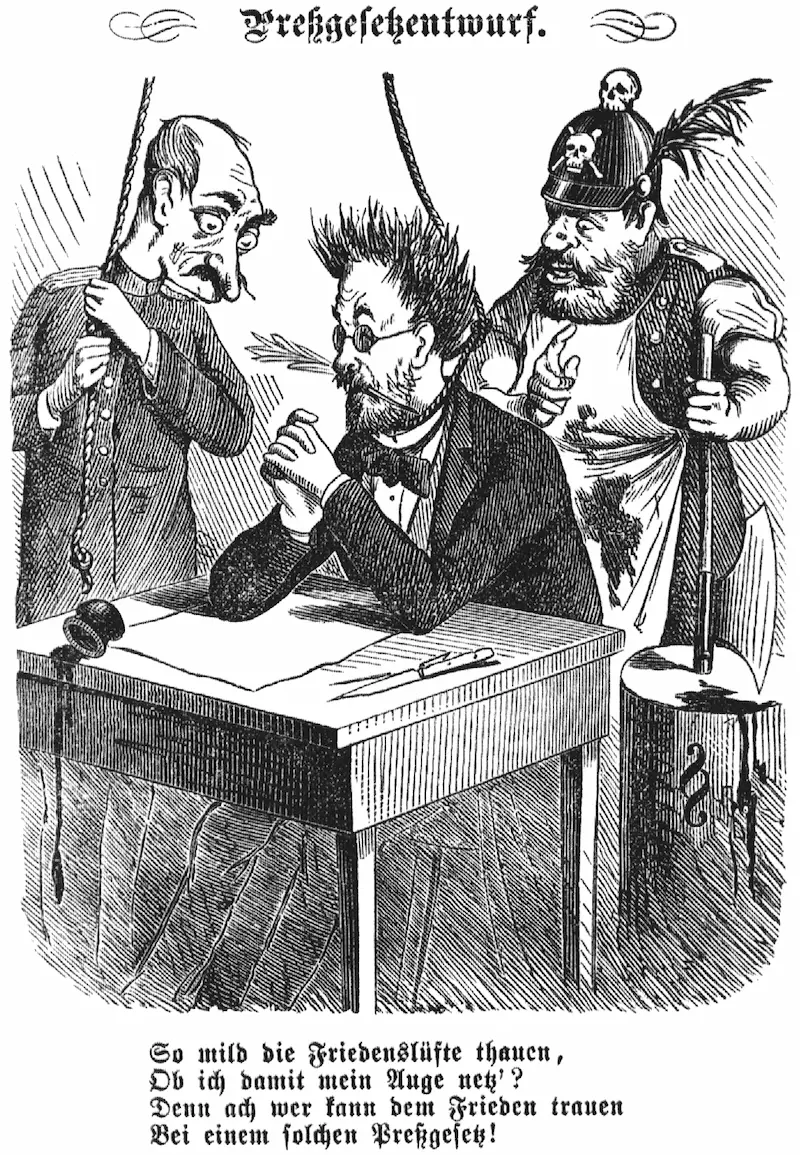 Frankfurter Latern 10/1874
Frankfurter Latern 10/1874
Freie Presse mit Beschlagnahm - Friedrich Stoltze über Zensur und fehlende Pressefreiheit im 19. Jahrhundert
06.06.2024, 18:30 Uhr in Frankfurt am Main
 Schneckenhörner aus Neuguinea und von der Molukken-Insel Seram. Sammlung Weltkulturen Museum © Wolfgang Günzel
Schneckenhörner aus Neuguinea und von der Molukken-Insel Seram. Sammlung Weltkulturen Museum © Wolfgang Günzel
Klangquellen. Everything is Music!
03.01.2024 — 01.10.2024 in Frankfurt am Main
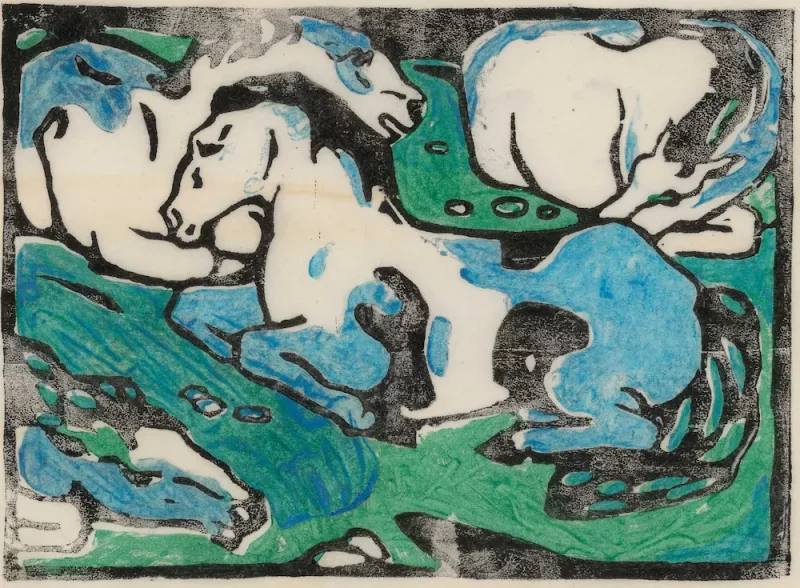 Franz Marc, Ruhende Pferde, 1911/12, Farbholzschnitt © Privatsammlung/Georgios Michaloudis
Franz Marc, Ruhende Pferde, 1911/12, Farbholzschnitt © Privatsammlung/Georgios Michaloudis
Das Tier in der Kunst des Expressionismus
21.09.2024 — 19.01.2025 in Aschaffenburg
 Kulturreferat Eschborn
Kulturreferat Eschborn
Zwischen Arkadia und Utopia
26.05.2024, 14:00 Uhr in Aschaffenburg